Inhalte des Kurses "Fortbildung Energieeffizienz-Expertenliste 24 UE"
Liste der Lernmodule im Kurs
- Grundlagen des GEG
- Grundlagen der DIN V 18599
- Vermeidung und Beseitigung von Schwachstellen
- Planung der Gebäudetechnik - Grundlagen
- Wirtschaftlichkeitsberechnung
- Energieeffiziente Gebäudehülle
- Einführung E-Learning mit GeWeB
Download der Inhalte
 Diese Inhalte als PDF herunterladen
Diese Inhalte als PDF herunterladen
Einführung in das Gebäudeenergiegesetz
Einführung in das Gebäudeenergiegesetz
Ziele des Gebäudeenergiegesetzes, Treibhauseffekt, Entwicklung des GEG, Fassungen der EnEV und Neuerungen des GEG, Rechenverfahren des GEG, Referenzierte Normen, Gliederung des GEG, Gesetzestext, Anlagen, Sommerlicher Wärmeschutz, Bestandsgebäude, Energiebilanzen, Energieausweis, Allgemeine Bestimmungen, Begriffsbestimmungen, EU-Gebäuderichtlinie
Anforderungen an Gebäude
Gliederung des GEG, Anlagen, Anforderungen an zu errichtende Gebäude, Wärmeversorgung im Quartier, Wohngebäude, Nichtwohngebäude, Anforderungen an bestehende Gebäude, Änderung von Gebäuden, Rechnerischer Nachweis, Energieausweise, Randbedingungen für Wohn- und Nichtwohngebäude, Primärenergiefaktoren
Anlagen des Gebäudeenergiegesetzes
Anlagen des GEG, Anlage 1 - Referenzgebäude bei Wohngebäuden, Anlage 2 - Referenzgebäude bei Nichtwohngebäuden, Anlage 3 - Höchstwerte der Wärmedurchgangskoeffizienten bei Nichtwohngebäuden, Anlage 4 - Primärenergiefaktoren, Anlage 5 - Vereinfachtes Nachweisverfahren bei Wohngebäuden, Anlage 6 - Nutzungsprofil für das vereinfachte Berechnungsverfahren bei Nichtwohngebäuden, Anlage 7 - Höchstwerte der Wärmedurchgangskoeffizienten bei Änderungen, Anlage 8 – Wärmedämmung von Rohrleitungen und Armaturen, Anlage 9 - Umrechnung in Treibhausgasemissionen, Anlage 10 - Energieeffizienzklassen von Wohngebäuden, Anlage 11 - Inhalte der Schulung, Anwendbarkeit, Anlagenkonzepte, Anforderungen an die Gebäudehülle
Anforderungen an Heizungsanlagen
Hintergrund zur Nutzungspflicht erneuerbarer Energien, Einführung, § 71 Anforderungen an eine Heizungsanlage, § 71a Gebäudeautomation, § 71b Anforderungen bei Anschluss an ein Wärmenetz und Pflichten für Wärmenetzbetreiber, § 71c Anforderungen an die Nutzung einer Wärmepumpe, § 71d Anforderungen an die Nutzung einer Stromdirektheizung, § 71e Anforderungen an eine solarthermische Anlage, § 71f Anforderungen an Biomasse und Wasserstoff einschließlich daraus hergestellter Derivate, § 71g Anforderungen an eine Heizungsanlage zur Nutzung von fester Biomasse, § 71h Anforderungen an eine Wärmepumpen- oder eine Solarthermie-Hybridheizung, § 71i Allgemeine Übergangsfrist, § 71j Übergangsfristen bei Neu- und Ausbau eines Wärmenetzes, § 71k Übergangsfristen bei einer Heizungsanlage, die sowohl Gas als auch Wasserstoff verbrennen kann; Festlegungskompetenz, § 71l Übergangsfristen bei einer Etagenheizung oder einer Einzelraumfeuerungsanlage, § 71m Übergangsfristen bei einer Hallenheizung, § 71n Verfahren für Gemeinschaften der Wohnungseigentümer, § 71o Regelungen zum Schutz von Mietern, § 71p Verordnungsermächtigung zu dem Einsatz von Kältemitteln in elektrischen Wärmepumpen und Wärmepumpen-Hybridheizungen, Übergangsfristen
Energieausweise
Muster der Energieausweise, Verbrauchsausweis, Energieausweis nach GEG, Treibhausgasemissionen, Ausstellung der Ausweise, Verkauf und Vermietung von Immobilien, Modernisierungsempfehlungen, Ausstellungsberechtigung für Energieausweise, Bedarfsausweis, Angaben im Energieausweis, Immobilienanzeigen, Energieeffizienzklasse, Registrierung von Energieausweisen, Anrechnung von gebäudenah erzeugtem Strom
Anwendung des Gebäudeenergiegesetzes
Referenzgebäudeverfahren für Wohngebäude
Prinzip, Primärenergie, Transmissionswärmeverluste, Referenzgebäude, Gebäudehülle, Heizung, Warmwasser, Lüftung, Kühlung, Randbedingungen, Berechnung, Zonierung, Sommerlicher Wärmeschutz, Strom aus erneuerbaren Energien
Witterungsbereinigung
Notwendigkeit und Prinzipien, Ermittlung des Energieverbrauchs, Zeitabschnitte, Umrechnung Heizwert, Energieverbrauch Heizung, Energieverbrauch Warmwasser, Bereinigung des Energieverbrauchs, Vorgehensweise bei der Bereinigung des Energieverbrauchs, Klimafaktoren, Besonderheiten bei Wohngebäuden, Zuschlag für Warmwasser, Zuschlag für Kühlung, Primärenergieverbrauch, Berücksichtigung von längeren Leerständen, Vorgehensweise bei längeren Leerständen, Leerstandsfaktor, Besonderheiten bei Nichtwohngebäuden, Verbrauch von Wärme und Strom, Energieverbrauchsermittlung in Sonderfällen, Ermittlung der Energiebezugsfläche, Vergleichswerte für den Energieausweis, Treibhausgasemissionen, Teilenergiekennwerte, Beispiel Berechnung Vergleichswerte
DIN V 18599 - Einführung
Energetische Bewertung von Gebäuden
Bedeutung der DIN V 18599, Aufbau der DIN V 18599, Indizierung, Anwendungsbereiche der DIN V 18599, Grundsätze der Energiebilanzierung, Bilanzzeit und Bilanzraum, Zonierung, Energien für die Bilanzierung, Beleuchtung, Trinkwarmwasser, Luftaufbereitung, Nutzwärme und Nutzkälte
Durchführung der Bilanzierung
Gesamtablauf, Berechnungsschritte, Iteration, Nutzenergie, Aufteilung, Wärme und Kälte, RLT-Anlage, Energieverluste, Heizung, Kühlung, Befeuchtung, Trinkwarmwasser, Innere Wärmequellen und -senken, Endenergie, Endenergien der Erzeuger, Hilfsenergien, Primärenergie, Primärenergiefaktoren, Umrechnungsfaktoren, Externe Wärme- bzw. Kältelieferung
Zonierung
Einführung, Bilanzraum und Zone, Zonierungsregeln, Zusätzliche Kriterien (gleiche Nutzung), Zusätzliche Kriterien (Raumkühlung), Versorgungsbereiche, Verrechnung von Bilanzteilen, Beispiel (Norm), Bestimmung Nutzenergiebedarf, Fall 1: Versorgungsbereich = Zone, Fall 2: Mehrere Versorgungsbereiche je Zone, Fall 3: Mehrere Zonen je Versorgungsbereich, Systemgrenzen, Grundriss, Gebäudeschnitte, Luftvolumen und lichte Raumhöhe, Charakteristische Länge und Breite, Ein-Zonen-Modell, Typische Fälle, Pauschalierte Hüllflächenzuweisung
Monatsbilanzverfahren
Bilanzierung, Nutzwärme- und Nutzkältebedarf, Randbedingungen, Wärmesenken und -quellen, Transmission, Lüftung, Interne Senken und Quellen, Solare Gewinne und Abstrahlung, Speicherung von Wärme, Ausnutzung von Wärmequellen, Monatliche Heiz- und Kühlzeit, Heizzeit, Kühlzeit, Beispiel
Ausnutzung von Wärmequellen
Wärmespeicherfähigkeit, Planungsgrundsätze, Zeitkonstante, Ausnutzungsgrad, Begrenzung
Luftaufbereitung
Grundlagen, Raumkühlung, Vorgehensweise, Anlagenschemata, Symbole
Elektrische Bewertungsleistung für Kunstlicht
Einführung, Tabellenverfahren, Minderungsfaktor Sehaufgabe, Anpassungsfaktor Lampe, Anpassungsfaktor Raum, Vereinfachtes Wirkungsgradverfahren, Leuchten- und Lampenparameter, Beleuchtungsanlagen im Bestand, Fachplanung, Wartungsfaktor
Heizungsanlagen
Energetische Berechnung von Heizungsanlagen, Heizungsarten, Bestandteile, Randbedingungen, Belastung, Temperaturen, Nennleistung des Wärmeerzeugers, Betriebszeiten, Wärmebedarf, Wärmeerzeugung mit elektrischem Strom, Fern- und Nahwärmenutzung
Grundlagen der Raumlufttechnik und Kühlung
Kühlung von Gebäudezonen, Klimasysteme, Raumlufttechnik, Bauelemente, Ventilator-Kennwerte, Wärmerückgewinnung, Zulufttemperatur, Raumkühlung, Klimaanlagen, Energetische Berechnung, Vorgehen
Nutzenergie für Raumlufttechnik und Kühlung
Raumkühlung und Luftaufbereitung, RLT-Anlage, Verluste RLT-Heizung, Verluste RLT-Kühlung, Leckagen, Bedarfszeiten, Raumkühlung, Befeuchtung
Trinkwassererwärmung
Trinkwarmwasser, Erwärmung von Trinkwasser, Randbedingungen, Wärmebedarf, Endenergie, Hilfsenergie, Wärmeeinträge infolge Warmwassers, Fern- und Nahwärmenutzung, Elektro-Durchlauferhitzer, Direkt beheizte Trinkwarmwasserspeicher
Nutzungsrandbedingungen Nichtwohngebäude
Erläuterungen, Trinkwarmwasser, Nutzungsprofile, Gemeinsame Randbedingungen
Gebäudehülle
Wärmebrücken
Definition von Wärmebrücken, Arten von Wärmebrücken, Stoffliche Wärmebrücken, Geometrische Wärmebrücken, Berücksichtigung des Wärmeverlustes von Wärmebrücken, Berechnungsschema zur Ermittlung der zusätzlichen Wärmebrückenverluste, Linienförmige Wärmebrücken, Punktförmige Wärmebrücken, Beispiel, Praktische Handhabung des zusätzlichen Wärmeverlustes, Vergleich der Auswirkung der drei Berechnungsmethoden, Pauschaler spezifischer Wärmebrückenzuschlag, Wärmebrückendurchgangskoeffizient, Werte für Wärmebrückendurchgangskoeffizienten, Ausführungsbeispiele, Temperaturfaktor, Empfehlungen für die Planung und energetische Betrachtung, Thermografie
Luftdichtheit
Warum Luftdichtheit?, Grundlagen der Luftdichtheit, Planung und Ausführung, Typische Leckagen, Phänomen bei Hochlochziegeln, Luftdichtheitsmessung, Blower-Door-Test, Praktisches Vorgehen, Auswertung der Ergebnisse, Lokalisierung von Leckagen, Wirtschaftlichkeit, Indikatorgasverfahren, Thermographie, Planungsempfehlungen, Prinzipskizzen zur Lage der Luftdichtheitsschicht, Überlappungen (Bahnen), Anschlüsse (Bahnen), Durchdringungen (Bahnen), Stoß im Regelquerschnitt (Platten), Anschluss an Mauerwerk und Beton (Platten), Fensteranschlüsse, Fugen
Anlagentechnik
Schwachstellen der Anlagentechnik
Bewertungskriterien, Alter der Anlage, Technischer Zustand der Anlage, Schäden an der Anlage, Brennstoffverbrauch, Komfort, Leistung des Wärmeerzeugers, Einhaltung gesetzlicher Grenzwerte, Wirtschaftlichkeit
Heizung, Lüftung, Warmwasser
Heizungssysteme
Begriff und Aufgaben, Symbole, Geschichte der Heiztechnik, Einteilung von Heizungssystemen, Einzelheizungen, Kamine und Öfen, Gasheizgeräte, Elektroheizgeräte, Zentralheizungen, Warmwasserheizungen, Hydraulischer Abgleich, Luftheizungen, Dampfheizungen, Korrosion, Einsatz fossiler Energieträger, Einsatz regenerativer Energieträger, Fern- und Nahwärme, Kraft-Wärme-Kopplung, Heizkostenabrechnung, Schall- und Brandschutz
Bestandteile von Heizungsanlagen
Aufbau von Warmwasserheizungen, Wärmeerzeuger, Kesselarten, Brenner, Hydraulischer Anschluss, Verteileinrichtungen, Rohrarten, Rohrführung, Pumpen, Raumheizeinrichtungen, Heizkörper, Heizflächenexponent, Flächenheizungen, Auswahlkriterien, Wirkungs- und Nutzungsgrade, Verluste, Lagerung von Brennstoffen, Jahresbrennstoffbedarf, Abgasführung, Sicherheitstechnische Einrichtungen, MSR-Technik
Heizlastberechnung
Überblick Heizlastberechnung, Begriffe, Heizlast von Gebäuden, Berechnung nach DIN EN 12831, Randbedingungen, Transmissionsverluste, Temperatur-Reduktionsfaktoren, Wärmebrücken, Erdreich, Äquivalente U-Werte, Lüftungsverluste, Mindestluftwechsel, Infiltration, Lüftungsanlagen, Wiederaufheizung, Temperaturabfall, Norm-Heizlast, Vereinfachtes Verfahren, Wärmeverluste, Formblätter, Bestimmung bei Bestandsgebäuden, Auslegungsberechnung durch Leistungsbilanz, Auslegung von Raumheizeinrichtungen, Rohrleitungen, Wärmeerzeuger
Trinkwassererwärmung
Überblick Trinkwassererwärmung, Beispiel Wasserversorgung, Symbole, Trinkwasserverbrauch, Aufbereitung, Trinkwarmwasserbedarf, Anhaltswerte Warmwasserbedarf, Einteilung der Systeme, Dezentrale WWV, Boiler, Durchlauferhitzer, Warmwasserspeicher, Zentrale WWV, direkte Beheizung, indirekte Beheizung, Ladespeicher, Kombisysteme, Rohrsystem, Solare Warmwasserbereitung, Warmwasserbereitung durch Wärmepumpen, Hygiene
Dimensionierung von Warmwasserbereitungsanlagen
Grundlagen der Dimensionierung, Leistungskennzahl, Leistungskennzahl - Begriffe, Einheitswohnung, Komfortausstattung, Belegungszahl, Ermittlung der Bedarfskennzahl, Beispiel, Systemauswahl, Bedarfszahlen, Summenlinienverfahren, Erfahrungsformel Speicher
Grundlagen der Raumlufttechnik
Aufgaben der Raumlufttechnik, Luftströme, Einsatz von Lüftungsanlagen, Randbedingungen, Symbole, Differenzierung von Systemen, Freie Lüftung, Selbstlüftung, Fensterlüftung, Schachtlüftung, Thermodynamische Aufbereitung der Luft, Umluftanlagen, Über- und Unterdruckanlagen, Hoch- und Niederdruckanlagen
Aufbau von Lüftungsanlagen
Einfache Lüftungsanlagen, Außenwand- und Fensterlüftung, Abzüge, Schachtlüftung, Luftheizung, Klimaanlagen, Nieder- und Hochdruckanlagen, Ein- und Zweikanalsysteme, Nur-Luft- und Luft-Wasser-Klimaanlagen, Anlagenbestandteile, Filter, Ventilatoren, Schalldämpfer, Mischkammern, Lufterwärmer, Luftkühler, Luftwäscher, h,x-Diagramm, Dampfbefeuchter, Luftentfeuchter, Anwendung eines h,x-Diagramms
Wärmerückgewinnung
Grundlagen der Wärmerückgewinnung, Rekuperative Systeme, Kreislauf-Verbund-Wärmetauscher, Heat Pipes, Regenerative Systeme, Rotations-Wärmetauscher
Einsatz von regenerativen Energien
Einsatz von Erneuerbaren Energien
Entwicklung des Energieverbrauchs, Erneuerbare Energien als Wirtschaftsfaktor, Regenerative Energiequellen, Anwendung von Erneuerbaren Energien, Primärenergieverbrauch, Aufteilung der Erneuerbaren Energien, Zuwachs Erneuerbarer Energien, Kohlendioxid-Emissionen, Kosten durch Umweltschäden, Nutzung Erneuerbarer Energien in Europa
Regenerative Energieträger und deren Nutzung
Biomasse, Kohlenstoffkreislauf, Umwandlungsanlagen, Windenergie, Nutzung der Windenergie, Probleme bei der Windenergienutzung, Erdwärme, Tiefe Geothermie, Hochenthalpie-Lagerstätten, Niederenthalpie-Lagerstätten, Tiefe Erdwärmesonden, Oberflächennahe Geothermie, Geothermie zur saisonalen Speicherung, Speicherarten, Potenzial und Nutzung von Erdwärme, Solarenergie, Solarthermie, Bestandteile von Solaranlagen, Kollektorsysteme, Größe und Auslegung, Photovoltaik, Kraft-Wärme-Kopplung, Wärmepumpe, Prinzip der Wärmepumpe, Brennstoffzelle
Sonnenenergie
Sonneneinstrahlung, Solarkonstante, Sonnenstand, Air Mass, Nennleistung von Solarmodulen, Strahlungsleistung, Ausrichtung von Solarmodulen, Neigungswinkel
Thermische Solarenergienutzung
Wärme aus Sonneneinstrahlung, Einsatzgebiete, Typische Anlagengrößen, Großtechnischer Einsatz, Solarkraftwerke, Bestandteile thermischer Solaranlagen, Kollektoren, Kollektorwirkungsgrad, Flachkollektoren, Vakuumröhrenkollektoren, Luftkollektoren, Speicher, Solarkreislauf, Solarstation und Solarregler
Photovoltaik
Strom aus Sonnenenergie, Halbleiter, Solarzellen, Arten von Solarzellen, Schichten der Solarzellen, Parallel- und Reihenschaltung, Wirkungsgrade, Verschattung von Solarmodulen, Solarstromanlagen, Inselanlagen, Netzgekoppelte Anlagen, Wechselrichter, Verwendung von Photovoltaik-Modulen, Potenzial
Wirtschaftlichkeit
Wirtschaftlichkeitsberechnung
Wirtschaftlichkeit von Sanierungsmaßnahmen, Grundbegriffe der Betriebswirtschaft, Abzinsung, Preissteigerungen, Kostenarten, Statische Verfahren, Dynamische Verfahren, Annuitätenmethode, Annuitätsfaktor, Barwertfaktor, Kapitalgebundene Auszahlungen, Restwert, Bedarfs- und verbrauchsgebundene Auszahlungen, Betriebsgebundene Auszahlungen, Sonstige Auszahlungen, Randbedingungen der Anwendung, Anlagenkomponenten, Äquivalenter Energiepreis
Grundlagen Wärmebrücken
Wärmebrücken
Definition von Wärmebrücken, Arten von Wärmebrücken, Stoffliche Wärmebrücken, Geometrische Wärmebrücken, Berücksichtigung des Wärmeverlustes von Wärmebrücken, Berechnungsschema zur Ermittlung der zusätzlichen Wärmebrückenverluste, Linienförmige Wärmebrücken, Punktförmige Wärmebrücken, Beispiel, Praktische Handhabung des zusätzlichen Wärmeverlustes, Vergleich der Auswirkung der drei Berechnungsmethoden, Pauschaler spezifischer Wärmebrückenzuschlag, Wärmebrückendurchgangskoeffizient, Werte für Wärmebrückendurchgangskoeffizienten, Ausführungsbeispiele, Temperaturfaktor, Empfehlungen für die Planung und energetische Betrachtung, Thermografie
Kontrolle der Wärmebrückenfreiheit
Bedeutung von Wärmebrücken, Wärmedämmung erdberührter Umfassungsflächen, Aufbringen einer Perimeterdämmung auf eine Kelleraußenwand, Fensterbrüstung und Fensterlaibung, Rollladen, Wärmedämmung am Ortgang, Dachfläche aus Beton, Auskragende Balkonplatten, Fensterstürze, Ausbildung eines Sockelbereiches in der Wärmedämmung, Beispiel für einen ausgebildeten Sockelbereich, Beispiele für Perimeterdämmung, Fehlende Perimeterdämmung, Anordnung der Fenster in Bezug zur Außenwand, Dämmung des gesamten Dachraumes
Thermografie
Einführung Thermografie, Einsatzbereich der Thermografie, Anwendungsgrenzen der Thermografie, Grundlagen der Thermografie, Auffinden von Wärmebrücken, Anwendung der Thermografie
Innen- und Kerndämmung
Grundlagen Innendämmung
Einführung Innendämmung, Einsatzbereiche für Innendämmung, Denkmalschutz, Vorteile der Innendämmung, Nachteile der Innendämmung, Brandschutz, Gebäudesituation, Unterschiede Innen- und Außendämmung, Raumklima
Feuchteschutz bei Innendämmung
Bauphysikalische Wirkung von Innendämmungen, Aufsteigende Feuchte, Dampfbremsen und -sperren, Feuchtigkeitstransport, Hinterströmung, Feuchtemanagement, Schimmelproblematik, Anwendbarkeit des Glaser-Verfahrens, Beschichtungen und Befestigungen
Planung, Berechnung und Ausführung Innendämmung
Vorgehensweise, Ausführung von Innendämmmaßnahmen, Tauwasserschutz, Schlagregenschutz, Wärmebrücken, Planung von Innendämmmaßnahmen, Bauphysikalischer Nachweis, Konstruktionsdetails, Wirtschaftlichkeit und Fördermöglichkeiten, Fachwerk, Bestandsaufnahme, Vereinfachtes Nachweisverfahren nach WTA, Beispiel: Verarbeitung von Mineraldämmplatten
Grundlagen Kerndämmung
Ein- und zweischalige Außenwände, Abdichtung, Anker, Weiterentwicklung der zweischaligen Außenwände, Wegfall der Luftschicht, Kerndämmung mit Putzschicht, Vor- und Nachteile der Kerndämmung, Vorgaben des GEG zur Kerndämmung, Brandschutz
Ausführung und Planung der Kerndämmung
Wann kommt eine Kerndämmung in Frage?, Allgemeine Bestimmungen für zweischalige Wandkonstruktionen, Abfangungen, Abdichtung, Nachträgliche Herstellung einer Kerndämmung, Durchführung des Einblasens, Einsatz von Ortschaum
Materialien für die Kerndämmung
Übersicht, Vorsatzschale, Grundsätzliches zu Dämmstoffen, Anwendung der Dämmstoffe, Kennwerte der Dämmstoffe und maßgebende Prüfnormen, Stoffnormen, Anker, Dämmmaterialien, Schäume, Plattendämmstoffe, Einblasdämmstoffe, Fertigteile mit Kerndämmung, Wirtschaftlichkeit von Dämmmaßnahmen
Planung luftdichter Gebäude
Grundlagen luftdichter Gebäude
Materialien für die Herstellung der Luftdichtheitsebene, Warum wird Luftdichtheit gefordert?, Beispiele für luftdichte Anschlüsse und Verbindungen, Luftdichte Anschlüsse von Fenstern, Bedeutung der Luftwechselrate für die Nutzung des Gebäudes, Luftdichte Konstruktionselemente, Luftdichte Anschlüsse, Messung und Kontrolle der Luftdichtheit, Herstellung der luftdichten Hülle, Dauerhaftigkeit, Wie erreicht man Luftdichtheit bei einem Gebäude?, Unterschied zwischen Luftdichtheit und Winddichtheit
Fehler bei der Herstellung der Luftundurchlässigkeit und Konstruktionsempfehlungen
Verwahrung der Folie, Immer wieder die gleichen Fehler, Decke über einem Versammlungsgebäude, Beschädigungen der Folie, Kritik: Was wurde hier nicht richtig gemacht?, Mängelentdeckung, Undichte luftdichte Hülle, Folgerungen
Blower-Door-Test
Blower-Door-Test, Einbau der "Blower"-Tür, Praktisches Vorgehen, Ventilator für den Differenzdruck, Steuerpanel des Ventilators, Leckagesuche mit dem Blower-Door-Test, Offener Kamin, Auswertung der Ergebnisse, Lokalisierung von Leckagen, Kombination mit Thermografie
Grundlagen sommerlicher Behaglichkeit und sommerlichen Wärmeschutzes
Sommerliche Behaglichkeit
Thermische Behaglichkeit, Einflussfaktoren, Beurteilung des thermischen Komforts, Strahlungsasymmetrie, Vertikales Temperaturprofil, Weitere Kriterien für Behaglichkeit, Zugluft, Fußbodentemperatur, Schwüle, Raumorientierung und -geometrie , Innere Wärmelasten, Raumtemperaturen, Anlagentechnik, Einteilung in Kategorien
Nachweis des sommerlichen Wärmeschutzes
Berechnung nach DIN 4108-2, Sommerklimaregionen, Änderungen durch neue Normfassung, Nachweisführung, Raum- und Fenstermaße, Sonneneintragskennwert-Verfahren, Vorhandener Sonneneintragskennwert, Zulässiger Sonneneintragskennwert, Kritik am vereinfachten Verfahren, Simulationsrechnung, Abminderungsfaktoren für Sonnenschutzvorrichtungen, Randbedingungen für den zulässigen Sonneneintragskennwert
Beispielrechnung sommerlicher Wärmeschutz
Beispielgebäude, Gebäudeparameter, Vorhandener Sonneneintragskennwert, Zulässiger Sonneneintragskennwert, Variante 1 - Sonnenschutzglas, Variante 2 - Nachtlüftung, Gegenüberstellung der Ergebnisse
Lernfunktionen
Anleitung zur Lernplattform
Vorbemerkung, Systemvoraussetzungen, Zugang zur Lernplattform, Startseite, Lernen, Lerneinheiten, Letzten Lehrpfad öffnen, Notizen, Bearbeitungsstand, Forum, Posteingang, Nachricht senden, Kommunikation, Inhaltliche FAQ, Zusatzmaterial, Externe Dokumente, Empfohlene Literatur, Materialien, Postarchiv, Technische Frage, Inhaltliche Frage, Suche, Beispiele für Suchanfragen, Hilfe, Anleitung, Programme und Plug-ins, Technischer Support, Inhaltliche Betreuung, Allgemeines, Gliederung der Lerninhalte, Einstellungen
Anleitung zu den Lehrpfaden
Vorbemerkung, Struktur der Lerninhalte, Bearbeitung der Lerneinheiten, Lehrpfade, Aufbau der Lehrpfad-Ansicht, Navigation durch den Lehrpfad, Lernzielseite, Lerninhalte, Tests, Testauswertung, Notizfunktion, Ausdruck der Lehrpfade, Eingabe und Bearbeitung von Notizen, Fragetypen
Änderungen vorbehalten.
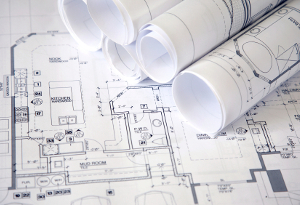
Details
Kurstitel: Fortbildung Energieeffizienz-Expertenliste 24 UE
Umfang: 48 LE*
Preis: 528,- € zzgl. MwSt.
Kursbeginn: jederzeit
* Lerneinheit à 45 Minuten
Anmeldung
Eine Anmeldung zu diesem Online-Kurs ist schriftlich, per Fax, online oder telefonisch möglich.
 Anmeldeformular Fortbildung Energieeffizienz-Expertenliste 24 UE.pdf
Anmeldeformular Fortbildung Energieeffizienz-Expertenliste 24 UE.pdf
Nach einer Buchung bleibt der Kurs ein Jahr lang für Sie freigeschaltet, alle Aktualisierungen und Updates sind in dieser Zeit für Sie kostenlos.
SIE HABEN NOCH FRAGEN?
Rufen Sie uns an:
06151 / 860 35 14
Oder schreiben Sie uns:
beratung@geweb.de
Oder benutzen Sie unser
Kontaktformular:
Demoversionen
Testen sie uns! Die Demoversionen unserer Lehrpfade sind frei zugänglich und können beliebig oft geöffnet und ausprobiert werden.
Bitte deaktivieren Sie für die Nutzung Ihren Popup-Blocker. Weitere Hinweise zur Funktionalität der Demoversionen finden Sie hier.